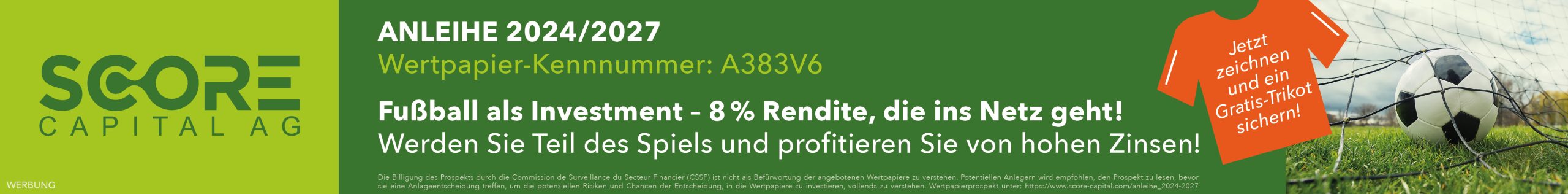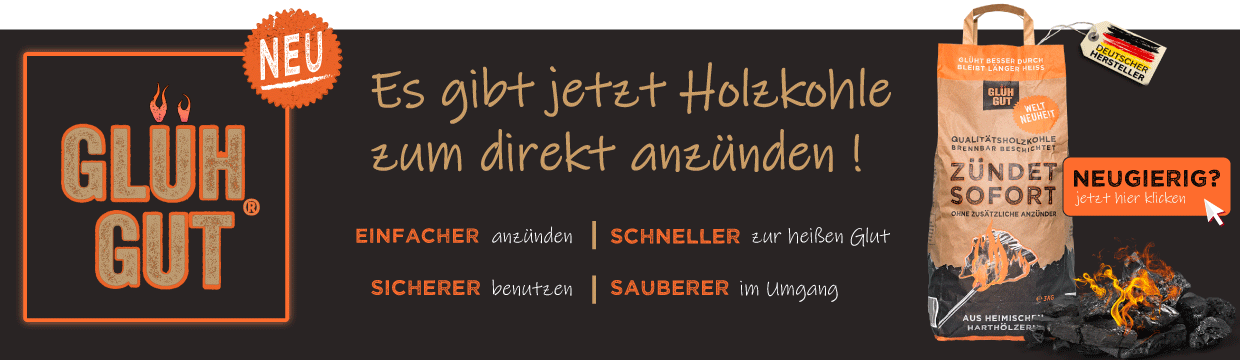Aufräumen muss jeder irgendwann, doch die wenigsten machen es gerne. Expertinnen verraten, wie es zum Kinderspiel wird – auch bei Dauerstress.
Schon wieder türmt sich der Wäscheberg, zig Papiere fliegen ungeordnet rum, Staubflusen ebenso, der Abfall gehört nach unten gebracht und der Geschirrspüler müsste auch mal wieder ausgeräumt werden. Chaos also. Aber keine ruhige Minute, um es einzudämmen. Kennen Sie das?
Die eigenen vier Wände sauber und ordentlich zu halten, fällt im hektischen Alltag nicht immer ganz leicht. Was hilft? Vier Schritte zum Nachmachen.
1. Welche Ordnung passt zu mir?
Manch einer entspannt beim Staubwedeln, einem anderen bereitet schon der Gedanke an Wischlappen, Staubsauger und Co. Stress. Ordnung zu schaffen, ist ein höchst individueller Prozess. «Wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen im Leben gemacht, die sich auch auf das Thema Aufräumen beziehen lassen», erklärt die Diplom-Psychologin und Ordnungscoachin Daniela Pawelczak.
Gunda Borgeest, Ordnungscoachin und Fachbuchautorin («Ordnung nebenbei. Aussortieren, aufräumen, aufatmen»), sieht das so: «Es gibt nicht die eine Ordnung, die wir zu erfüllen haben. Ordnung kann man nicht verordnen.» Sie entwickele sie vielmehr gemeinsam und auf Augenhöhe mit den Menschen, die sich an sie wenden würden.
Grundsätzlich sei dabei zwischen dem Ausmisten und dem täglichen Aufräumen zu unterscheiden, sagt Borgeest. Um eine Grundordnung in die eigenen vier Wände zu bringen, sollte man sich Zeit nehmen. «Das Ausmisten ist ein Tiefenreinigungsprozess, der über Monate gehen kann. Wenn man diese Reduktion gut bewerkstelligt hat, ist das tägliche Aufräumen relativ einfach.»
2. Ausmisten nach Kategorien
Und Ordnung zu schaffen, das heißt fast immer eines: zu reduzieren. Ob Hosen, Brotzeitboxen oder Schuhe – die meisten Menschen haben von vielem zu viel im Schrank. «Es ist aber nicht unbedingt das Ziel, Minimalismus in jeden Haushalt zu tragen. Man sollte Klarheit darüber bekommen, was man braucht und möchte», sagt Daniela Pawelczak.
Mit dem Ausmisten beginnt man dann am besten in kleinen Etappen. «Eine Woche lang von morgens bis abends das Haus auf den Kopf zu stellen, das macht unser Nervensystem nicht mit», so die Diplom-Psychologin. Beginnen Sie außerdem mit Kategorien, die Ihnen leicht fallen. Das können zum Beispiel Kleidungsstücke sein, denn sie werden über die Jahre ohnehin häufiger ausgetauscht.
Überhaupt sei es sinnvoll, grundlegende Ordnung durch das Sortieren von einzelnen Kategorien zu schaffen, rät Gunda Borgeest, und nicht nach Schrank. Man sortiert also in Etappen alle Schuhe, alle Taschen, alle Handtücher und so weiter. «So erkennt man erst, wie viele Dinge man von einer Kategorie besitzt. Dieser mögliche Schock kann beim Loslassen helfen.»
Außerdem hilfreich – und zudem nachhaltig: noch brauchbare Dinge nicht wegwerfen, sondern karitativen Organisationen spenden. «Für das Loslassen hilft es zu wissen, dass jemand sich über die Dinge freut und sie weiter nutzt», sagt Borgeest. Von strengen Regeln, etwa Dinge nach einem Jahr ohne Benutzung wegzuwerfen, hält die Expertin allerdings nicht viel. Das sei für viele Menschen zu schematisch und zu rigoros.
3. Mikroroutinen etablieren
«Nehmen Sie sich pro Etappe zwei bis drei Stunden Zeit und tragen Sie diese Slots als verbindliche, kontinuierliche Termine in Ihren Kalender ein», rät Borgeest. Und: «Vergessen Sie nicht, das Aussortierte sofort wegzubringen! Nur so stellt sich ein Befreiungsgefühl ein, das Sie dann zur nächsten Etappe trägt!» Zudem sollte man darauf achten, sich nicht zu viel zuzumuten und Zeit für das Aufräumen nach dem Ausmisten einzuplanen, empfiehlt Daniela Pawelcza. Außerdem wichtig: sich selbst für die Arbeit loben.
Ist der Hausstand dann erstmal reduziert und hat alles seinen Platz, gilt es tägliche Putzroutinen einzuführen. «Dabei würde ich immer damit anfangen, wo der Schuh am meisten drückt und der Effekt am größten ist», sagt Pawelczak.
Helfen kann es, sogenannte Mikroroutinen zu etablieren. Also etwa Liegengebliebenes wegräumen, während der Wasserkocher das Teewasser erhitzt. Oder bei jedem Gang in den ersten Stock etwas mitnehmen. Grundsätzlich sinnvoll: sich angewöhnen, Dinge nach ihrer Nutzung möglichst sofort wieder an ihren Platz zu räumen. Kleine, festgelegte Putzetappen ließe das Gehirn oftmals eher zu als großangelegte Reinigungen, so die Diplom-Psychologin.
4. Für Motivation sorgen
Und letztlich sollte Zeitnot beim Aufräumen keine Rolle spielen. «Wenn ich sage, ich habe keine Zeit, meine ich eigentlich, es ist mir nicht wichtig genug.» Um die Motivation nicht zu verlieren, hilft es Pawelczak zufolge, Vorher-Nachher-Fotos zu machen. Und einen möglichen Perfektionismus abzulegen. Negativ-Sätze wie «Das klappt doch eh nicht», «Ich bin zu müde» oder «Ich muss immer allen hinterher räumen» gelte es bewusst gegenüberzutreten und sich stattdessen klarzumachen, warum es wichtig ist, die Aufgabe zu erledigen.
Nicht aufzuräumen ist schließlich auch keine Lösung. Zumindest nicht auf Dauer. Beim Ordnung halten gehe es darum, Entscheidungen zu treffen, sagt Pawelczak. «Das macht unser Gehirn nicht so gerne, denn es ist anstrengend. Also legt man einen Gegenstand oft auf die nächste freie Fläche, wo schon bald ein Häufchen von Dingen entsteht.»
Statt sich den Fragen zu stellen, was man wirklich braucht und wo es hin soll, schieben wir Entscheidungen auf, wenn wir keine Ordnung halten. Beim Blick auf die Unordnung dringe dabei jedoch, oft unbewusst, immer wieder die Info in unser Gehirn, dass es noch etwas zu erledigen gäbe. «Das ist auf Dauer sehr anstrengend. (dpa/ml)