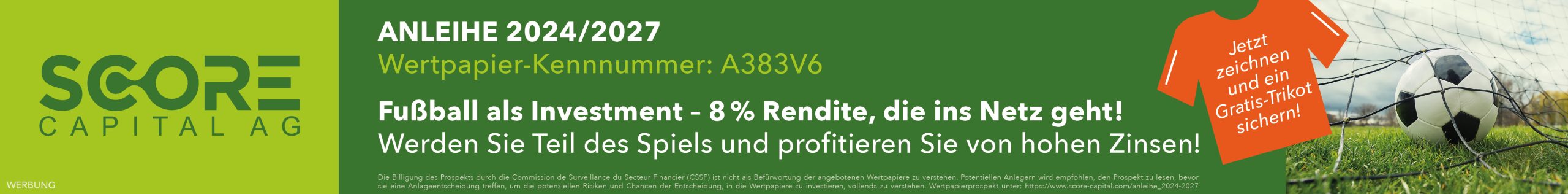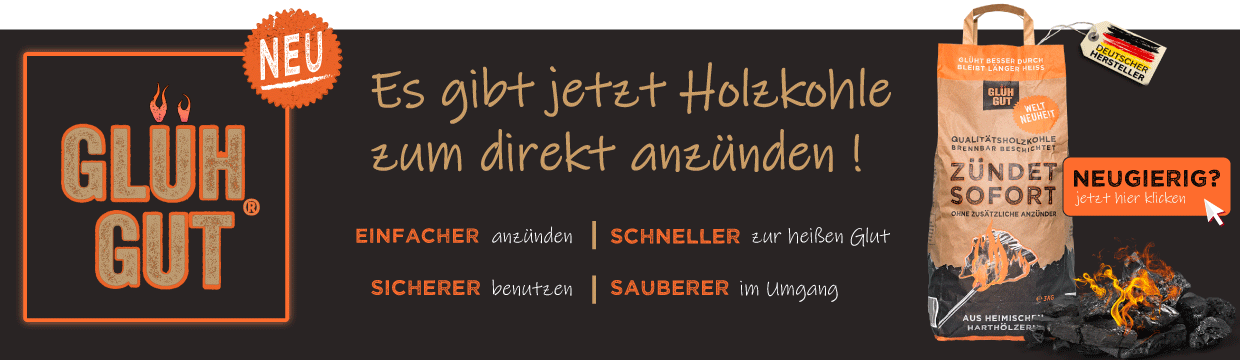Für viele Menschen in anderen Ländern mag es schwer nachvollziehbar sein, warum Millionen Amerikaner Donald Trump erneut in Regierungsverantwortung sehen wollen. Doch es gibt Gründe:
Der persönliche Faktor
Obwohl Donald Trump Milliardär und seit Jahrzehnten Teil der amerikanischen Elite ist, wirkt er für viele US-Bürgerinnen und Bürger nahbar. Er redet wie der Typ an der Bar, dem auch mal ein falsches Wort herausrutscht. Er sagt frei raus, was er denkt und kann auch auf den Tisch hauen. Und er ist als Kämpfer bekannt, nicht erst seit den Attentatsversuchen auf ihn. Das scheinen Qualitäten zu sein, die Wählerinnen und Wähler auch im Weißen Haus sehen wollen. Hingegen wird die Professionalität von Vizepräsidentin Kamala Harris und ihre Fähigkeit, fokussiert zu bleiben, von einigen als elitär und nicht authentisch wahrgenommen.
Dass alles heißt aber nicht, dass die meisten Amerikaner Trump mögen oder sogar lieben. Tatsächlich gehen Umfragen davon aus, dass die Mehrheit einen unvorteilhaften Eindruck von seiner Persönlichkeit hat. Für diese Menschen ist Trump oft trotzdem wählbar. Zum einen, weil einige als Präsidenten gerade keinen Heiligen wollen. Zum anderen, weil Trump Positionen vertritt, die ihnen wichtig sind.
Die Weltuntergangsrhetorik der Demokraten für eine zweite Amtszeit des verurteilten Straftäters Trump hat bei vielen nicht gezogen – schließlich war der 78-Jährige ja schon einmal für vier Jahre im Weißen Haus und fing weder Kriege an noch zerstörte er die amerikanische Wirtschaft. Damalige Skandale, Chaos und Kontroversen können leichter abgetan werden.
Money, Money, Money
Wohl keine Gesellschaft der Welt hat sich mehr einem Turbokapitalismus verschrieben, der stark auf liberalisierte Märkte, geringe staatliche Eingriffe und die Idee des freien Unternehmertums setzt. Das Thema «Wirtschaft» steht bei vielen Wählerinnen und Wähler stets oben auf der Agenda. Doch im Wahlkampf war damit selten (das starke) Wachstum gemeint oder die allgemeine Ausrichtung der Volkswirtschaft. Es war viel Einfacher: Wie teuer sind Joghurt, Eier, Chips und Bier im Supermarkt – und wie viel kostet das Benzin?
Infolge der Corona-Pandemie hatte die Inflation die Preise – nicht nur in den USA – nach oben getrieben. Das spürte jeder Wähler jeden Tag im Portemonnaie, auch wenn die Löhne mit der Zeit aufholten. Schuld gaben viele der Wirtschaftspolitik von Präsident Joe Biden und seiner Stellvertreterin Harris. Ihrem Frust verliehen sie mit ihrer Stimme Ausdruck und stellten ihre persönlichen Finanzen damit wohl über Themen wie persönliche Tugenden oder demokratische Werte.
Die Abgehängten
Trumps treueste Basis sind vor allem weiße Männer ohne Universitätsabschluss. Statistiken zeigen, dass das Einkommen dieser Gruppe in den USA 1980 deutlich über dem amerikanischen Durchschnitt lag – heute liegen sie klar darunter. In einer Gesellschaft, in der die Techbranche oder die Finanzindustrie den immensen Reichtum des Landes noch stärker in Metropolen vor allem an den Küsten konzentrieren, funktioniert das System für die Arbeiter in den früher industriell geprägten Bundesstaaten wie etwa Pennsylvania nicht mehr.
Doch Trump legte nun auch bei anderen Bevölkerungsgruppen zu, unter anderem bei den Latinos, die bislang für die Demokraten eine sehr wichtige Zielgruppe waren. Bei diesem großen Wählerblock von Menschen mit einem lateinamerikanischen Hintergrund konnte Harris nicht so stark punkten wie gehofft. Und selbst bei schwarzen Männern hatte der amtierende Präsident Joe Biden vor vier Jahren ersten Daten zufolge besser abgeschnitten als nun seine Stellvertreterin Harris.
Die Angst vor dem «weiter so»
In den USA gibt es ein Sprichwort: Manchmal muss man Eier zerschlagen, um ein Omelette zu braten. Will heißen: Manchmal muss man Dinge kaputt machen, um sie zu reparieren. Harris wurde von vielen als Establishment-Kandidatin gesehen. Trump, der Anti-System-Mann, versprach im Wahlkampf hingegen radikalen Wandel: Unter ihm als Präsident werde alles anders, Harris dagegen stehe als Mitglied der aktuellen Regierung für ein «weiter so», lautete die Argumentation.
Damit traf er einen Nerv: Viele in den USA haben den Eindruck, dass sich etwas ändern muss. Sie fühlten sich angesprochen, wenn Trump die USA düster als Land im Niedergang beschrieb, das von Migranten überrannt werde. Der 78-Jährige scheint einen untrüglichen Instinkt dafür zu haben, was den Menschen Sorgen macht. In Nachwahlbefragungen gaben 73 Prozent seiner Wähler an, am wichtigsten sei ihnen gewesen, dass Trump einen notwendigen Wandel herbeiführen könne.
Harris, der Vizepräsidentin, gelang es nicht, sich ausreichend vom amtierenden Präsidenten Joe Biden abzusetzen. Es gebe nicht viel, dass sie in den vergangenen vier Jahren anders gemacht hätte, sagte sie im Wahlkampf. Außerdem hatte sie nicht viel Zeit, sich mit eigenen Ideen bekannt zu machen. Gut möglich, dass bei den Demokraten nun die Debatte ausbrechen wird, ob Bidens Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen zu spät kam – und Harris letztlich den Sieg kostete.
Keine schwarze Frau als Präsidentin
Es gibt Bevölkerungsgruppen, die sich noch immer nicht vorstellen können, dass eine Frau das mächtigste Land der Welt führt. Zwar haben in den USA in den vergangenen Jahren mehr Frauen etwa als Gouverneurinnen politische Führung übernommen. Doch vor allem in den Südstaaten und anderen konservativ geprägten und oft ländlichen Teilen des Landes denken viele anders. Im sogenannten Bible Belt («Bibelgürtel») ist evangelikaler Protestantismus integraler Bestandteil der Kultur – und Feminismus für viele fast schon ein Schimpfwort. Dass Harris keine leiblichen Kinder hat, kommt dort auch nicht gut an.
Außerdem sind Rassismus und Benachteiligung von Schwarzen und anderen Minderheiten in vielen Teilen der USA strukturell tief verankert, wie Statistiken aus allen gesellschaftlichen Bereichen immer wieder zeigen. Zusammengenommen kommt man auf eine Art rassistischen Chauvinismus, der Harris Stimmen gekostet haben dürfte. Trump bediente diese Ressentiments im Wahlkampf gezielt.
Laut Nachwahlbefragungen hat Trump bei evangelikalen Christen, bei Protestanten und bei Katholiken mit großem Abstand mehr Stimmen geholt als Harris. Viele Trump-Wähler machten ihre Wahlentscheidung demnach davon abhängig, wem sie das Führen zutrauen. Harris-Wählern dagegen war zum Beispiel wichtiger, wer ein gutes Urteilsvermögen hat.
Die weltpolitischen Aussichten
Oft war vor der Wahl spekuliert worden, ob der Nahost-Konflikt die Demokraten Stimmen kosten würde. Für viele Amerikaner jüdischer Herkunft ging Bidens Unterstützung von Israel nicht weit genug – und vielen arabischstämmigen Bürgern wiederum zu weit. Das spiegelt sich in den Nachwahlbefragungen: Eine große Mehrheit der Trump-Wähler gab an, die USA sollten Israel stärker unterstützen.
Noch mehr könnte aber den Ausschlag gegeben haben, dass Trump die USA aus internationalen Konflikten weitgehend raushalten will. Er verspricht zum Beispiel, den Krieg in der Ukraine schnell zu beenden – wahrscheinlich mit schlimmen Folgen für das von Russland angegriffene Land. Manche US-Bürger sehen dabei aber vor allem, dass dann weniger von ihrem Steuergeld dorthin fließen muss. (dpa/cw)