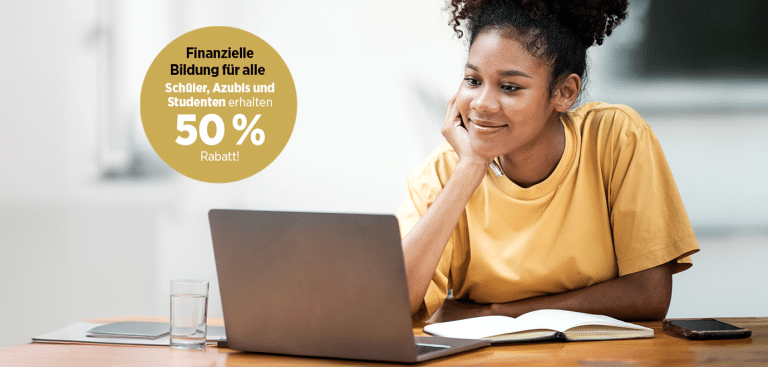Hier ist mehr drin, davon wäre weniger gut, und dieses müsste noch schneller gehen. Ja, vieles könnte besser laufen. Aber ab wann wird Selbstoptimierung zum Problem? Wir fragen die Soziologin Anja Röcke.
Von Pauline Schinkels
Achtsamer werden, fitter sein, effektiver arbeiten: Selbstoptimierung steht im Mittelpunkt gegenwärtiger sozialer Anforderungen und individueller Sinnwelten. Das schreibt die Berliner Soziologin Anja Röcke. Aber was genau bedeutet Selbstoptimierung eigentlich und wann wird die Dauerverbesserung bedenklich?
Courage: Frau Röcke, die erste Jahreshälfte ist vorbei, Pfunde sind vielleicht gepurzelt, neue Bücher gelesen, wir haben endlich mehr Zeit mit der Familie verbracht. Sind wir jetzt alle optimiertere Menschen?
Anja Röcke: Das kommt darauf an, in welchem Kontext das Ganze steht. Nicht jedes Sporttraining folgt einer Steigerungslogik, die für eine Selbstoptimierung charakteristisch ist. Wenn ich allerdings anfange, meine Daten aufzuzeichnen, mein Training peu à peu zu intensivieren und erreichte Ergebnisse immer weiter verbessern will, dann geht das in Richtung Selbstoptimierung. Aber es gibt auch Menschen, die ihre Leistungsdaten aus gesundheitlichen Gründen erfassen – ohne sich optimieren zu wollen. Bei Schlafstörungen oder Diabetes macht es beispielsweise Sinn, sich selbst zu vermessen. Es dient schließlich der Gesundheitsvorsorge.
Aber die meisten verfolgen damit doch eher das Ziel, einem gesellschaftlichen Schönheitsideal zu entsprechen. Während der Pandemie berichteten Ärzte von einer Zunahme der Schönheitsoperationen, vor allem im Gesicht. Angeblich, weil sich die Menschen aufgrund der Videotelefonate häufiger selbst gesehen haben.
Auch Schönheitsoperationen können die Folge eines psychischen Unwohlseins oder sogar einer Depression sein. Dann wird eine Operation sogar ärztlich angeordnet. Man muss bei der Frage nach Selbstoptimierung also immer auch die persönlichen Motive und die Rahmenbedingungen in den Blick nehmen.
Wo hört denn die Selbstfürsorge auf und wo fängt zwanghafte Selbstoptimierung an?
Bei der Selbstfürsorge geht es nicht um Leistungsforderungen, sondern darum, sich gesund und wohl in seinem Körper zu fühlen. Selbstoptimierung hingegen steht für ein instrumentelles Selbstverhältnis: Ich versuche, systematisch mit spezifischen Mitteln meine Fähigkeiten, mein Aussehen oder meine Kompetenzen zu optimieren. Und das lässt sich zugespitzt ins Unendliche steigern: Ich kann in diesem Optimierungsprozess immer weiter gehen, um meine Leistung zu steigern – immer mit dem Ziel, besser als das Mittelmaß zu werden.
Und die sozialen Medien erleichtern es zu sehen, wie man gesellschaftlich performt?
Ja, die sozialen Medien spielen bei der Selbstoptimierung eine große Rolle. Über Tracking-Apps kann ich beispielsweise meine Trainingsdaten sehr einfach online hochladen und mit anderen vergleichen. Außerdem sehe ich überall im Internet Bilder, die ein bestimmtes gesellschaftliches Schönheitsideal vermitteln, wie ich heutzutage auszusehen habe. Das Karrierenetzwerk LinkedIn ist ein gutes Beispiel für die momentane Vergleich- und Sichtbarkeit und letztlich auch Selbstdarstellung. Der Berliner Soziologie Andreas Reckwitz hat einmal gesagt: Wir kuratieren heutzutage unser Leben. Das heißt, wir überlegen genau, wie wir gesehen werden wollen, und optimieren unsere Präsentation entsprechend.
Also ist Selbstoptimierung erst mit dem Liken, Vergleichen und Folgen in den sozialen Medien in der Breite der Gesellschaft angekommen?
Selbstoptimierung gibt es nicht erst, seitdem wir in sozialen Netzwerken aktiv sind. Denken Sie nur an die Verbreitung des modernen Leistungssports Anfang des 19. Jahrhunderts. Ab dieser Zeit wird, ausgehend von den USA, auch das Streben nach Erfolg populär. Später, in den 1960er- und 1970er-Jahren, folgt eine Fitnessbewegung. In Deutschland sammeln sich in dieser Zeit die ersten Lauftreffs. Gleichzeitig erodiert das Normalarbeitsverhältnis. An dessen Stelle treten flexiblere Arbeitsmodelle. Soziale Sicherungssysteme werden abgebaut. Und die Digitalisierung der vergangenen 20 Jahre ermöglicht uns, dass wir heutzutage rund um die Uhr sehr intime Körperdaten von uns erfassen und in unseren Alltag integrieren können. All diese kulturellen, technischen und ökonomischen Entwicklungen haben dazu geführt, dass der Gedanke, uns selbst zu optimieren, heute so plausibel erscheint und so verbreitet ist.
Das heißt, Selbstoptimierung lässt sich auch als Antwort auf einen drohenden sozialen Abstieg deuten?
Diesen Zusammenhang sehe ich auf jeden Fall. Selbstoptimierung kann ein Mittel sein, um die individuelle Rolle im Wettbewerb zu stärken. Corona hat diese Situation sogar noch einmal verschärft. Wer privilegierteren Berufen nachgeht, kann ins Homeoffice wechseln und spart viele Stunden, weil Arbeitswege wegfallen. Dann bleibt auch mehr Zeit zum Joggen oder für eine Weiterbildung. Wer aber im Supermarkt, im öffentlichen Nahverkehr oder in der Pflege arbeitet, der hat nicht nur einen viel gefährlicheren Job, sondern schlicht nicht die Zeit, sich um seine Selbstoptimierung zu kümmern.
Stichwort „gutes Leben“: Bedeuten das ständige Vergleichen und die grenzenlosen Möglichkeiten der Selbstoptimierung nicht auch permanenten Stress?
Das ständige Vergleichen und Optimieren kann Stress bedeuten und ein Auslöser von Frust sein, mit langfristigen negativen Konsequenzen für Gesundheit und Psyche. Selbstoptimierung ist das Gegenteil von Muße, von Gelassenheit, von In-sich-Ruhen. Stattdessen zielt sie auf einen permanenten Aktivismus ab – es muss immer weiter, immer höher, immer besser gehen.
Wann kann dieser Selbstbezug ins Negative kippen? Wenn ich mich ausgiebig mich mit mir selbst beschäftige, bleiben vielleicht weniger Möglichkeiten, mich um andere zu kümmern?
Diese Diskussion ist nicht neu. Christopher Lasch sprach schon in den 1970er-Jahren von einer „Kultur des Narzissmus“, also der extremen Selbstbeschäftigung und Selbstfindung. Die gängige Kritik lautet: Wer zu viel Zeit mit sich selbst verbringt, dem fehlt die Energie für ein gesellschaftliches oder politisches Engagement, um in der Nachbarschaft auszuhelfen oder für Familie und Freunde da zu sein. Natürlich kann das passieren, wenn Selbstoptimierung das zentrale Lebensziel ist und alle Energie in die eigene Ernährung, Bewegung und Arbeit gesteckt wird. Aber das muss es nicht automatisch bedeuten. Wer seinen Fitness-Score verbessern möchte, kann trotzdem noch in der Kirche aktiv sein. Aber es bleibt ein Zeitproblem. Wir haben halt nicht endlos viel davon.
Was wäre denn eine Strategie, uns davon loszumachen? Sollen wir uns nicht mehr vermessen, nicht mehr bei LinkedIn schauen, welchen Berufen frühere Bekannte inzwischen nachgehen?
Sich nur zu informieren ist erst mal unproblematisch. Schwierig wird es erst dann, wenn man unter permanentem Druck steht, sich verbessern zu müssen. Um sich von diesem Drang zu lösen, kann es helfen, zu mehr Selbstakzeptanz zu finden. Und man sollte keine überzogenen Erwartungen an sich selbst formulieren. Schließlich wird es immer Leute geben, die besser sind. Natürlich ist das ambivalent. Es kann ja bereichernd und motivierend sein, an sich zu arbeiten, eine neue Sprache zu lernen oder eine Weiterbildung zu absolvieren. Aber da, wo es negative körperliche und psychische Konsequenzen hat, sollte man aufhören.
Sie schreiben, ein Grund für den Drang nach mehr Selbstoptimierung sei, dass die Sensibilität für die eigene Unzulänglichkeit gestiegen ist. Warum ist das eigentlich so?
Da spielt Werbung sicherlich eine große Rolle. All die fitten und schönen Körper springen einen heute ja von jeder Straßenecke und jeder Internetseite an. Das ist eine riesige Industrie, die Produkte vermarkten und Geld verdienen möchte. Außerdem kann ich auf den Schritt genau sehen, wie viel ich heute gegangen bin. Da gibt es auch einen gewissen Konformitätsdruck: Ich will die gesetzten 10 000 Schritte schaffen. Hat man sie erreicht, will man beim nächsten Mal vielleicht noch mehr Schritte absolvieren. Früher wusste ich überhaupt nicht, wie viel ich tagsüber gegangen bin. Heute habe ich sofort ein schlechtes Gewissen, sobald ich weiß, dass ich das Ziel verfehle.
Sie verstehen Selbstoptimierung auch als Antwort auf eine komplexer und komplizierter werdende Welt – in der wir uns wieder mehr auf uns zurückbesinnen.
Selbstoptimierung kann einem ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Handlungsmacht vermitteln. Gleichzeitig erleben viele in Zeiten eines Krieges, einer Pandemie und einer globalen Klimakrise ein gewisses Ohnmachtsgefühl. Selbstoptimierung ist hier also für manche eine individuelle Ausweichstrategie, ein Weg, zufriedener zu sein, indem man sich mehr auf sich selbst fokussiert. Gesellschaftliche Probleme lassen sich so allerdings nicht lösen.
Anja Röcke studierte in Berlin Sozialwissenschaften und promovierte anschließend am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. 2021 erschien ihre Arbeit „Soziologie der Selbstoptimierung“ im Suhrkamp Verlag. Seit vergangenem Jahr ist sie als Gastprofessorin am Lehrstuhl Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin tätig.